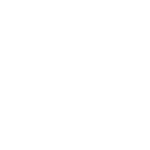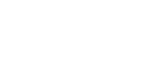Auf dem Weg in ein neues Leben
Für Julienne ist die Africa Mercy die Hoffnung auf ein Leben ohne Behinderung.
Julienne erzählt
Ich komme aus Kamerun, einem Land in Zentralafrika. Kamerun ist ein sehr abwechslungsreiches Land, denn bei uns gibt es Regenwälder, aber auch die Savanne. Wir haben den größten Berg Westafrikas, den aktiven Vulkan Kamerunberg. Insgesamt leben ca. 25 Millionen Menschen in Kamerun und unsere Landessprache ist Französisch, in Teilen aber auch Englisch. Ich lebe auf dem Land und kann neben Französisch auch noch unsere Stammessprache. Wir, die Kameruner, sind ein sehr gastfreundliches Volk. Wir lieben gemeinschaftliches essen, singen, tanzen, und auch wenn wir nicht viel haben, laden wir gerne andere Leute ein.
Ein kamerunisches Sprichwort besagt „Wer Kinder hat, hat auch Segen.“ Denn Kinder können arbeiten, Geld verdienen und die Eltern im Alter versorgen. Doch in meiner Familie glaubte man nicht an dieses Sprichwort. Warum? Weil ich kein Segen für die Familie war!
Auf krummen Beinen durchs Leben
Ich war noch ein Baby, als meine Mutter bemerkte, dass sich meine Beine ungewöhnlich krümmten. Was für ein Schock für meine Eltern. Bei einem Arzt in der Hauptstadt Yaoundé wurde meinen Eltern gesagt, dass meine Knie auseinander wachsen und so meine Beine in eine „Bogenform“ zwingen. Eine Operation wäre für ihn so kompliziert, dass er viel Geld dafür verlangen müsste. Für Erfolg könnte er aber nicht garantieren. Meine Eltern konnten sich die Operation für mich nicht leisten und kehrten traurig wieder zurück in unser Dorf. Ich war noch zu klein, um zu verstehen, was mit mir passierte, doch spürte ich Ablehnung von meinen Angehörigen und anderen Kindern. Tief in mir drin wusste ich, ich bin anders! Als ich älter wurde, begann ich auch langsam zu verstehen, warum mich andere ablehnten. Ich sah an mir herunter und sah, wie meine Knie so weit auseinander waren, ich hatte noch nie jemanden anderen mit solchen Beinen gesehen. Beim Laufen schwankte ich von einem Bein auf das andere und bei jedem Schritt schmerzten meine Knie. Lange stehen konnte ich überhaupt nicht. An den Tagen, an denen ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht fahren konnte, brauchte ich fast zwei Stunden quälender Anstrengung in der glühenden Sonne, um zur Schule zu kommen. Es wäre leicht gewesen, meine Ausbildung ganz aufzugeben, aber ich wollte nicht nur studieren, nein, ich hatte ein größeres Ziel vor Augen – ich wollte eines Tages selbst unterrichten und Lehrerin werden. Schon nach der Schule unterrichtete ich jüngere Kinder auf dem Dorfplatz. Ich liebte diese Verantwortung, obwohl meine langsamen und sorgfältigen Bemühungen, an die Tafel zu gehen, oft zu einem spöttischen Gelächter meiner Schüler führten. „Die ist doch eine Hexe“, wurde geflüstert. Nicht nur die Beleidigung verletzte mich zutiefst, sondern auch das Wort „Hexe“. Glaubte ich doch an Gott und Jesus und wollte nicht mit einer Hexe verglichen werden! Wie oft lag ich abends weinend im Bett und fragte Gott traurig: „Warum ich – von allen Menschen auf dieser Welt? Warum muss ausgerechnet ich diese Beine haben?“ Ich flehte Gott an, mir zu helfen. Wollte ich doch wie alle anderen Kinder sein, wollte studieren, für meine Eltern ein Segen sein und am liebsten auch selbst einmal heiraten und Kinder kriegen. Doch welcher Mann würde schon jemanden wie mich heiraten? Ich war doch eine Schande!
„Die ist doch eine Hexe“, wurde geflüstert.
Glaube an Gott
Ich erlebte viele Tiefpunkte, doch ich spürte immer wieder, wie Gott mir beistand und mich ermutigte, nicht aufzugeben. Durch seine Kraft schaffte ich es, jeden neuen Tag zu meistern und nie die Hoffnung aufzugeben, dass es doch noch einen Arzt gab, der mich operieren konnte.
Glaubst du daran, dass Gott Gebete erhört? Ich tue es! Denn anders kann ich es mir nicht erklären, wie ich das Glück hatte, von Mercy Ships zu erfahren.
Ich war ganz normal wie jeden Sonntag im Gottesdienst, doch dieses Mal saßen in der ersten Reihe „Watt“. So sagen wir zu den weißen Männern und Frauen aus einem anderen Land. Sie waren umringt von allen kleineren Kindern, die die Haut und Haare der Weißen anfassten. Bisher hatte ich nur von Menschen mit weißer Hautfarbe gehört, dass diese reich sind und in einem Land leben, in dem alles möglich ist. Viele von uns wünschen sich, dort zu leben.
Zum ersten Mal unter Weißen
Als ich also zum ersten Mal diese weißen Menschen sah, konnte ich nur staunen. Die Frauen sahen so unglaublich schön aus. Sie hatten helles Haar und die Augen von einer waren strahlend grün und die von der anderen Frau blau wie der Himmel. Die Männer dagegen sahen gar nicht so anders aus wie wir. Die hatten auch schwarze Haare und einer sogar braune Augen. Meine Freundin Sandrine, die neben mir saß, flüsterte mir zu, dass die Menschen Ärzte seien und einen heilen könnten. „Bestimmt auch dich, Julienne!“, sagte sie zu mir. Ab dem Moment konnte ich mich nicht mehr auf den Gottesdienst konzentrieren. Ich begann zu träumen und zu beten, dass Sandrine wirklich recht behielt und diese Menschen mir helfen konnten.
Nach der Predigt wurden die weißen Menschen nach vorne gerufen und sie erzählten uns Unglaubliches. In zwei Monaten würde ein großes Schiff kommen, auf dem es ein Krankenhaus und viele Ärzte gibt, die einen kostenlos operieren können. Davor müsse man aber zu einer Voruntersuchung kommen, die in Douala stattfinden würde. Wir sollten dies unseren Familien, Freunden und Nachbarn weitererzählen und kranke Leute zu dem Untersuchungstermin nach Douala schicken.
Aufgeregte Vorfreude
Als wir nach dem Gottesdienst zu Hause beim Essen saßen, war meine Mutter völlig aufgeregt und redete nur noch von der Reise nach Douala und das nun alles gut werden würde. Sie diskutierte mit meinem Vater, der das alles nicht glauben wollte und es für eine Falle hielt. Er war überzeugt, dass diese weißen Menschen nichts Gutes bringen werden, denn warum sollten sie einfach so kostenlos Menschen operieren? „Das sind auch Christen, die machen uns nichts!“, rief meine Mutter immer wieder und beharrte darauf, dass wir es wenigstens versuchen sollten. Ich war von den ganzen Ereignissen noch so überwältigt und konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Könnten diese Menschen mit dem Schiff mir wirklich helfen? Hätte ich danach gerade Beine und könnte richtig laufen? Und würde die Operation wirklich kostenlos sein? Hätte ich doch noch eine Chance auf ein normales Leben und könnte meinen Traum, Lehrerin zu sein, leben?
Als ich abends im Bett lag, schlief ich seit langer Zeit mit einem Lächeln ein. Voller Vorfreude, dass die zwei Monate schnell vorübergingen und ich mit meiner Mutter nach Douala zu den weißen Menschen reisen konnte.
Zwei Monate später
Endlich ging die Reise los! Noch nie war ich in dem über 500km entfernten Douala. Zum Glück konnten wir mit einem kleinen Bus fahren, denn zu Fuß hätte ich mit meinen Beinen niemals soweit laufen können. Es war schon dunkel, als wir in Douala ankamen und den Platz aufsuchten, an dem am nächsten Tag die Voruntersuchung von Mercy Ships stattfinden sollte. Ich traute meine Augen nicht! Es hatte sich bereits eine Menschenschlange gebildet. Nicht nur ich war der Einladung von Mercy Ships gefolgt, sondern auch noch viele andere Menschen. Direkt vor mir in der Schlange stand ein Mann, der hatte eine große Geschwulst im Gesicht, die war so groß wie eine Melone. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Ich sah die Menschenschlange entlang und konnte kaum glauben, was ich an den Menschen alles sah. Meine Mutter erklärte mir: „Weißt du Julienne, jeder von den Menschen hier hat etwas Anderes. Manche sind blind und können nicht sehen, andere haben einen Tumor im Gesicht oder am Hals und siehst du diesen kleinen Jungen da? Der hat Verbrennungen an seinen Armen.“ Auf einmal entdeckte ich zwei Kinder deren Beine verbogen waren. Die waren zwar anders verbogen, nicht so rund wie meine, aber ich konnte nicht glauben, dass es tatsächlich auf dieser Welt nochmals jemanden gab, der das gleiche Schicksal erleiden musste wie ich. Hatte ich doch Gott immer wieder gefragt: „Warum ich – von allen Menschen auf dieser Welt? Warum muss ausgerechnet ich diese Beine haben?“ Ich war gar nicht alleine!
Zahlreiche erkrankte Kinder, Jugendliche und Erwachsene warten geduldig auf ihre erste Untersuchung.
Als ich all diese Menschen sah überkam mich eine solche Traurigkeit. Ich fragte mich, warum es in unserem Land keine Ärzte gab, die so etwas verhindern konnten. Ärzte, die all diese kranken Menschen operieren würden. Warum konnte es sein, dass es andere Länder gab, in denen es solche Ärzte gibt und nicht bei uns in Kamerun. Warum nur? Einmal mehr dankte ich Gott, dass er Mercy Ships ausgerechnet nach Kamerun geschickt hatte, um all diesen Menschen zu helfen.
Hoffen und Warten
Meine Mutter und ich legten uns an unserem Platz hin, doch in der Nacht konnte ich kaum schlafen. Desto näher der Morgen und die Voruntersuchung kam, desto aufgeregter wurde ich. Hinter uns hatte sich die Schlange noch verlängert. Ich konnte das Ende nicht sehen! Langsam kamen mir die Zweifel. Warum sollte Mercy Ships ausgerechnet mir helfen? Es gab doch noch so viele andere Menschen, die auch Hilfe brauchten. Vielleicht waren meine Beine zu verbogen, sodass man sie nicht operieren konnte? Die Hoffnung auf Heilung schwand dahin und ich fing an zu weinen. Als meine Mutter das merkte, schimpfte sie mit mir. „Julienne wo ist dein Gottvertrauen hin? Er hat uns so weit gebracht, dass wird alles schon gut gehen!“ Wie ich schon sagte, ich hatte viele Tiefpunkte, doch auch in diesem Tiefpunkt spürte ich, wie Gott mich tröstete und mir neue Kraft und Mut gab. Halleluja!
Dann ging es los! Langsam bewegte sich die Menschenschlange vorwärts. Je weiter ich vorkam, desto mehr sah ich was vor sich ging. Viele weiße, aber auch schwarze Menschen in blauen Klamotten liefen herum und kümmerten sich um die Menschen. Einer nach dem anderen kam dran. Endlich ich! Ich war überrascht als eine Frau mich in verständlichem Französisch ansprach. Mir fiel ein Stein vom Herzen! Hatte ich doch befürchtet, dass mich niemand verstand und ich mich nicht mitteilen konnte. Mir wurde erklärt, dass ich nun an unterschiedlichen Stationen haltmachen muss und dort die Mercy Ships Mitarbeiter mich untersuchen und Fragen stellen. Ich bekam einen Zettel, den ich zu jeder Station mitnehmen sollte.
An der ersten Station wurde ich nach meinem Namen und meinem Zuhause befragt. Außerdem wollten sie meinen Geburtstag wissen. Ich war froh, dass ich die Fragen alle gut beantworten konnte. An der nächsten Station musste dann meine Mutter erzählen, wie es zu meinen verbogenen Beinen kam. Wie das alles anfing und ob wir vor Mercy Ships bei Ärzten waren. War ja klar, dass meine Mutter alles ausführlich erzählte und sie dabei weinen musste. Und das vor den weißen Mercy Ships Mitarbeitern! Echt peinlich! Ich war froh, als wir zur nächsten Station kamen und ich wieder reden konnte. Wobei reden musste ich eigentlich nichts, jetzt kam die erste Untersuchung. Ich musste mich auf einen Stuhl setzen und mir wurde Blutdruck und Fieber gemessen, das kannte ich schon von dem Arzt aus Yaoundé. Die Frau machte sich Notizen auf meinem Zettel und gab diesen mir zurück. Sie meinte jetzt müsse ich nochmals ein wenig warten, bis der Arzt Zeit hätte. Meine Mutter und ich nahmen auf den aufgestellten Bänken Platz und warteten. Es war inzwischen Mittagszeit und die Sonne brannte herab. Zum Glück verteilen die Leute dort Wasser, denn unser Vorrat war schon aufgebraucht.
Endlich die Untersuchung
„Julienne, du bist dran.“ Als mein Name genannt wurde, war die Aufregung mit einem Schlag wieder da. Jetzt würde der Arzt mich anschauen. Noch nie kam mir ein weißer Mann so nahe und hatte mich untersucht. Was er wohl mit mir machen würde? Hoffentlich wird er mich nicht auslachen, dachte ich. Als ich vor ihm stand und ihm in die Augen blickte, sah ich aber freundliche grüne Augen und keine Verachtung oder Ablehnung. Er schien über meine Beine auch gar nicht schockiert zu sein. Ich musste vor und zurücklaufen, der Arzt hob meine Beine an und versuchte die Beine zu drehen und tastete sie ab. Dann war ich auch schon fertig. Ich war ein wenig verwirrt, dass er nicht mehr gemacht hatte und das es so schnell ging. Er schaute mich nett an und sagte zu mir etwas auf einer anderen Sprache, was ich nicht verstand. Eine andere Frau übersetze für mich. Sie meinte:
„Liebe Julienne, es tut uns sehr leid, dass du all die Jahre mit diesen Beinen hast laufen müssen. Wir können dir helfen und dich operieren!
Dazu müssen wir aber noch weitere Untersuchungen, wie z.B. Röntgenaufnahmen auf dem Schiff machen. Das heißt du musst nochmals zu einem anderen Termin auf unsere Africa Mercy im Hafen kommen. An der nächsten Station wird man dir sagen, wann und wohin du kommen musst.“ Ich schaute die Frau und den Arzt ungläubig an. Hatte ich richtig gehört? Ich konnte operiert werden? Meine Beine konnten begradigt werden? Ich fühlte mich wie in einem Traum und erst als ich meine Mutter lachen und heulen sah und wie sie sich bei dem Arzt überschwänglich bedankte, realisierte ich: es ist wahr! Mir konnte geholfen werden! Halleluja!
Der erste Blick auf's Schiff
Ich konnte es immer noch kaum glauben, aber ich hatte wirklich einen weiteren Untersuchungstermin auf dem Schiff bekommen! Endlich war der Tag gekommen und ich würde das Schiff sehen. Mit meiner Mutter und anderen Bekannten überlegte ich, wie es wohl werden würde. Von uns war noch nie jemand in einem Hafen oder auf einem Schiff gewesen. Ob es wohl sehr schwanken würde? Und wie groß würde es sein? Viele Fragen gingen mir mal wieder durch den Kopf, doch als ich dann endlich am Hafentor mit meiner Mama ankam stellte ich schnell fest, dass das Schiff einfach nur riesengroß war. So groß, dass ich es vom Tor aus gar nicht komplett sehen konnte. Es war auch unglaublich hoch und hatte viele kleine Fenster und sogar nochmals andere kleine Boote darauf. Vor dem Schiff an Land sah ich viele Autos und ich fragte mich, wofür Mercy Ships so viele Autos brauchte, wenn die doch ein Schiff hatten! Später sollte ich noch erfahren, wofür das alles gut war. Von weitem sah ich auch eine kleine Luke mit einer Treppe. Das war also der Eingang! Zu diesem wurden wir dann auch geschickt. Wir sollten zwar nicht auf das Schiff gehen, aber bei den Wartebänken am Eingang warten, bis wir dran wären.
Und wieder heißt es Warten!
Als wir dem Eingang näher kamen und um die Ecke bogen, sah ich nicht nur den überdachten großen Wartebereich, sondern auch drei Zelte. Für was die wohl gut waren?
Während wir warteten, beobachtete ich die Menschen um mich herum. Immer wieder wurde jemand aufgerufen und verschwand dann in einem dieser Zelte. Nach einer Weile kam er oder sie wieder heraus und stieg dann mit einem Mercy Ships Mitarbeiter die Treppen nach oben und verschwand im Schiff. Manche wurden auch hochgetragen, da sie selbst nicht mehr laufen konnten. Die Treppe sah ganz schön steil aus und ich fragte mich, wie ich wohl da hochkommen sollte? Mit meinen krummen Beinen? Müsste man mich auch tragen? Das wollte ich auf keinen Fall! Ich wollte das alleine schaffen! Neidisch blickte ich auf andere Leute, die keine oder andere Krankheiten hatten. Die liefen leichtfüßig diese Stufen hoch und runter. Würde es mir auch bald so gehen? Würde ich eines Tages auch alleine und ohne Mühe solche Treppen meistern können? Oh wie schön das wäre!
Während ich in meine Gedanken versunken war, unterhielt sich meine Mutter mit anderen Wartenden. Eine Frau hatte große Angst. Sie meinte, dass Schiff würde einen verschlucken und wer es beträte, käme nicht mehr zurück. Meine Mutter versuchte sie zu beruhigen und zeigte ihr wie andere Menschen aus dem Schiff wieder an Land zurückkamen. Wie bei meinem Vater verstand ich nicht, warum manche Leute Angst vor den Weißen haben. Bisher waren alle so nett gewesen und hatten uns geholfen. Manchmal sind Erwachsene schon komisch!
Der nächste Arztbesuch
Endlich wurde ich aufgerufen! Ich betrat das Zelt und war überrascht was ich da alles sah.
Es war wie bei einem Arzt eingerichtet: Es gab einen Schreibtisch, Stühle, eine Liege, Papiere, Computer und kleine medizinische Geräte. Ich durfte mich setzen und ein Arzt schaute sich irgendwelche Unterlagen an, auf denen ich meinen Namen lesen konnte. Da er kein Französisch konnte, redete er auf Englisch und eine andere Frau übersetzte in meine eigene Sprache. So konnte sogar meine Mama alles mit anhören! Einfach super!
„Liebe Julienne,“ sagte er, „damit wir dich operieren können, müssen wir dir ein wenig Blut abnehmen, um zu schauen, ob du fit genug bist für eine Operation. Außerdem brauchen wir von deinen Beinen auch noch Bilder. Wir haben auf dem Schiff ein besonderes Gerät, das kann durch deine Haut hindurch Bilder machen, so dass wir deine Knochen sehen. Das ist für uns Ärzte dann besser zum Operieren und zum Überlegen, wie es weitergeht.“ Ich war ehrlich gesagt sehr verwirrt und hatte keine Ahnung was er meinte. Ich nickte aber einfach und hoffte, dass er mir keine weiteren Fragen stellen würde. Es kam dann aber schon eine Frau, die mich zu einer Liege begleitete, um mir Blut abzunehmen. Ich schaute lieber weg, Spritzen habe ich noch nie gemocht. Ich fragte mich, was die mit meinem Blut machen würden und als hätte die Frau meine Gedanken gelesen, sagte sie zu mir: „Wir haben ein eigenes Labor auf dem Schiff. Da können andere Mercy Ships Mitarbeiter dein Blut untersuchen und schauen, ob du fit genug bist!“ „Darf ich das Labor mal anschauen?“, fragte ich zurück. Ein wenig neugierig war ich schon, hatte ich doch so etwas noch nie gesehen. Die Frau konnte mir nichts versprechen, denn zuerst sollte ich ja alle Untersuchungen fertigmachen.
43 Stufen der Hoffnung
Ich konnte es kaum erwarten, endlich auf dieses Schiff zu kommen, bis ich auf einmal vor den Treppen stand. Ich hatte kurze Zeit vergessen, dass es ja noch diese Treppen gab und dass ich, um auf das Schiff zu kommen, erst einmal diese steilen Stufen bewältigen musste. „Gangway“ wurde die Treppe von den Mercy Ships Mitarbeitern genannt. Mir wurde es wieder ganz anders. Wie sollte ich diese Treppe nur meistern? Was wäre, wenn ich ausrutschte und nach unten flog? Oder mir doch jemand helfen und mich hochtragen musste? Meine Mutter stützte mich und meine Mercy Ships Begleiterin ermutigte mich. Sie meinte: „Es sind nur 43 Stufen, Julienne. Wir schaffen das zusammen!“ 43 Stufen. 43 Stufen der Hoffnung, die mit jeder Stufe mehr wuchs. Hoffnung, dass ich nach diesen Stufen der Heilung ein kleines Stückchen näher sein würde. Dass ich endlich dieses Schiff betreten und sich die Ärzte um mich weiter kümmern könnten. 43 Stufen, die mein Leben verändern würden. Langsam aber sicher bewegte ich mich nach oben und als ich die 43 Stufen erklommen hatte, schaute ich auf das Dock hinunter und auf das Hafengelände. Stand ich doch am Morgen noch am Tor und hatte sehnsüchtig hier hochgeschaut und jetzt? Jetzt stand ich da! Hatte die Stufen erklommen. Ich war einfach nur dankbar.
Endlich stand ich vor der Schiffstür und konnte die Africa Mercy betreten. Es war ganz schön kühl und ich begann zu frösteln, denn eine Klimaanlage war ich nicht gewöhnt. Es roch interessant nach Essen und die Frau erklärte mir, dass gleich im nächsten Raum ein riesiger Speisesaal für die über 400 Mitarbeiter wären. Sie führte mich zwei kurze Treppen hinunter, denn das Krankenhausdeck befand sich auf Deck 3. Ich war sehr froh, dass ich begleitet wurde, alleine hätte ich mich bestimmt verirrt bei diesen ganzen Gängen. Hinter einer großen Tür tat sich dann auf einmal das Krankenhaus auf. Krankenschwestern und Ärzte liefen herum, ich sah Patienten in Betten liegen und auch an einer Apotheke kamen wir vorbei. Dann wurde ich in einen seltsamen Raum gebracht mit Geräten, die ich noch nie gesehen hatte. Mir wurde erklärt, dass ich mich jetzt umziehen müsste und danach würden diese Röntgenbilder von mir gemacht. Meine Mutter musste draußen warten. Sie umarmte mich und schon war ich alleine mit den Mercy Ships Mitarbeiterinnen. Ich musste auf einem Klotz stehen und mich einmal sogar hinlegen. Richtig seltsam war, dass es jedes Mal dunkel wurde im Raum und dann Blitzlichter kamen. Zwischenzeitlich wurde auch mein Bauch mit irgendetwas anderem abgedeckt. Ich ließ die Mitarbeiter einfach alles mit mir machen und betete innerlich, dass alles gut gehen möge. Ich war so weit gekommen und war dankbar, hier zu sein. Warum sollte also jetzt noch etwas schiefgehen?
Mein OP-Termin steht fest!
Was ein Röntgenbild ist, begriff ich wirklich erst, als ich nach den ganzen Untersuchungen wieder draußen im Zelt bei dem Arzt saß und er mir auf den Bildern meine verbogenen Knochen zeigte. Ich konnte nicht glauben, dass dieses Gerät mich so fotografieren konnte. Unglaublich, was es alles gibt! Dieses Schiff war einfach klasse.
Als der Arzt uns die nächsten Schritte erklärte, verstand ich zwar wieder nur die Hälfte, aber ein Satz blieb bei mir hängen:
Julienne, hier ist dein OP-Termin.
„Du musst aber ein wenig Zeit einplanen, denn nach deiner OP musst du noch ein paar Tage auf dem Schiff bleiben und danach kommst du ins HOPE-Center, wo du nach deiner Operation wieder laufen lernst.“ Endlich war es soweit, der Tag an dem ich endlich gerade Beine bekommen sollte, stand fest! Ich konnte es kaum erwarten….
Endlich war es soweit und ich durfte auf die Africa Mercy für meine Operation. Ich konnte es kaum erwarten, endlich operiert zu werden! Der erste Tag war ein sehr langer Tag. Schon morgens in der Früh musste ich zum Schiff kommen. In einem der Zelte wurde mir nochmals Blut abgenommen, meine Mutter musste Papiere unterschreiben und uns wurde erklärt, wie alles ablaufen würde. Zum Beispiel wurde mir gesagt, dass ich nach der Operation einen Gips haben würde und dass dann zwar meine Beine begradigt wären, doch es noch einige Zeit dauern würde, bis ich wirklich alleine laufen könnte. Ich würde noch für eine Zeit in das Hope Center müssen, und Übungen machen und langsam wieder laufen lernen. Vieles davon verstand ich erst nach und nach. In diesem Moment war mir einfach alles egal, Hauptsache ich konnte wieder laufen! Am Nachmittag war es endlich soweit, ich durfte offiziell die Africa Mercy als Patientin betreten. Was für ein Moment! Dieses Mal schaffte ich die 43 Stufen sogar ganz alleine. Ich wurde zur Bettenstation gebracht und mir wurde ein Bett zugeteilt. An ausruhen und schlafen war aber überhaupt nicht zu denken, denn auf diesem Schiff gab es einfach unglaublich viel zu entdecken. Außerdem freundete ich mich gleich mit meinen Bettnachbarn an. Auch wenn ich inzwischen den Mercy Ships Mitarbeitern vertraute, war ich doch froh, dass in meinem Zimmer noch einige andere Kameruner lagen und wir uns gegenseitig unterstützen konnten.
Keine Angst vor der Narkose
Nach der ganzen Aufnahme in das Krankenhaus wollte mich ein Arzt nochmals untersuchen. Er hieß Dr. Frank Haydon und kam aus den USA. Er meinte zu mir: „Liebe Julienne, ich werde dich morgen operieren. Das ist Susan aus Österreich, sie ist Anästhesisten und wird dich morgen in eine Narkose verlegen, damit du von der Operation nichts mitbekommst. Deswegen darfst du dann auch morgen früh vor der Operation nichts essen.“
Von einer Narkose hatte ich von anderen schon gehört und ich war einfach nur froh, dass es anscheinend ein Mittel gab, was mich so tief in Schlaf versetzen konnte, dass ich von dieser ganzen Aktion nichts mitbekam. Wenn ich mir vorstellte, wie jemand an meinen Beinen herumdokterte, wurde es mir ganz anders und schlecht. Schnell verdrängte ich diese Gedanken wieder!
Nach dem Gespräch mit dem Arzt bekam ich ein tolles Abendessen und dann war auch schon bald Schlafenszeit. Die Krankenschwester Linda meinte, ich solle heute Nacht gut schlafen, dass ich morgen ausgeruht für die OP wäre. Die hatte gut reden! Es war meine erste Nacht auf einem Schiff und morgen war mein großer Tag mit der OP. Wie sollte man denn da schlafen können? Zum Glück hatte ich meine kleine Bibel dabei. Denn immer, wenn ich nicht mehr weiterwusste oder Trost brauchte las ich meinen Lieblingsvers aus Josua 1,9: „Sei mutig und entschlossen! Hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken; denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst!“ Jedes Mal, wenn ich diesen Vers las, wusste ich: Gott ist bei mir und trägt mich durch! Er verlässt mich nicht und ich muss keine Angst haben. Auch nicht vor einer Operation oder einer Narkose. Er wird mit beistehen. Mit dieser Gewissheit im Herzen schlief ich ein .
Endlich im Operationssaal
Der Tag der OP war da! Ich wurde in einem Rollstuhl abgeholt und kam in ein anderes Zimmer. Dort half mir eine Krankenschwester, mich auszuziehen und einen blauen Kittel anzuziehen. Dann durfte ich mich auf ein Bett legen und wurde in einen anderen Raum geschoben, wo ich operiert werden sollte. Sowas hatte ich noch nie gesehen. In diesem OP-Saal waren noch viel mehr Geräte, Lichter und viele silberne Gegenstände auf einer Platte. Wieder überkam mich die Angst, doch Susan, die Narkosefrau, beruhigte mich und betete mit mir zusammen und meinte dann: „Keine Angst Julienne, nun bekommst du wie erklärt deine Narkose und wirst einschlafen. Und wenn du wieder aufwachst, sind deine Beine gerade! Darauf darfst du dich freuen!“ Mit dieser Hoffnung und Vorfreude bin ich dann eingeschlafen.
Das nächste an was ich mich erinnern kann ist, dass ich langsam aufwachte, einige Menschen um mich herumstanden und mir Fragen stellten und ich einfach nur weiterschlafen wollte. Ich konnte kaum meine Augen aufhalten und fragte mich wo ich war. Nur langsam konnte ich meine Gedanken sammeln. Ich war auf der Africa Mercy! Ich wurde gerade operiert! Hatte ich jetzt wirklich gerade Beine? Wie würde ich nun aussehen? Könnte ich endlich normal laufen?
Erst am Tag später konnte ich realisieren, das was ich nicht zu hoffen gewagt hatte, war nun in Erfüllung gegangen: meine Beine waren nicht mehr verbogen. Ich war Gott und Mercy Ships einfach nur unglaublich dankbar.
Schnell wurde ich wacher, denn ich wollte unbedingt wissen, ob die Operation funktioniert hatte. Ich schaute an mir herab und sah, dass meine Beine weiß eingewickelt waren. Ich erinnerte mich, dass mir jemand erzählt hatte, dass ich einen Gips bekommen würde, doch dass das nun so aussah, war mir nicht klar. Ich wollte meine Beine bewegen, aber es war alles so hart und schwer und weh tat es auch. Ich war unglaublich müde und konnte es noch gar nicht richtig fassen.
Die ersten Schritte
Acht weitere Tage war ich noch auf der Africa Mercy auf Station B. In meinem Zimmer lagen noch weitere Kinder mit Gipsfüßen und wir hatten viel Spaß, lachten und spielten. Doch eines hassten wir alle: jeden Tag mussten wir unser Bett zu verlassen und mit einem Gehbock laufen. Das erste Mal war wirklich fast unerträglich. Der Gips war schwer und in diesen seltsamen Schuhen hatte man kein richtiges Gefühl. Außerdem tat es weh. Ich musste von zwei Leuten gestützt werden, um überhaupt einen Schritt vorwärtszukommen. Es war mir zwar vorher schon gesagt worden, dass der Weg nicht einfach sein würde, aber das es dann so hart werden würde, hatte ich mir nicht vorgestellt. Trotzdem biss ich die Zähne zusammen und hielt durch, denn ich hatte ja ein großes Ziel! Ich wollte ganz normal auf geraden Beinen laufen können! Zum Glück wurde es von Tag zu Tag langsam besser und nach einer Woche auf der Africa Mercy wurde ich ins HOPE Center verlegt. Ich war schon sehr gespannt, was mich dort alles erwarten würde…..
"Ich wollte tanzen vor Freude!"
Während der Nachbehandlung im HOPE-Center lernte ich, immer besser mit meinen Gipsfüßen zu laufen. Trotzdem konnte ich es kaum erwarten, den Gips loszuwerden und endlich meine geraden Beine zu sehen. Als ich mal wieder bei einem Untersuchungstermin auf dem Schiff war, strahlte die Physiotherapeutin mich an: „Liebe Julienne, heute ist es so weit. Nun kommt dein Gips für immer ab.“ Ich konnte es nicht glauben!
Zuerst wurden an beiden Beinen mit einer Säge jeweils die Gipshälften entfernt. Mit einer Säge! Ich hatte Panik und konnte erst kaum hinschauen! Dabei hatte mir die Physiotherapeutin versichert, dass es für die Haut völlig ungefährlich sei. Doch als ich nach und nach immer mehr von meinen Beinen erkannte, schossen mir die Tränen in die Augen. Meine Beine waren wirklich gerade!
Am liebsten hätte ich getanzt vor Freude, doch das konnte ich noch nicht. Erst einmal musste ich lernen, ohne Gips zu laufen – mit Krücken. Am Anfang tat es sehr weh und ich musste bei jedem Schritt die Zähne zusammenbeißen. Aber ich wusste: Es würde besser werden. Die Physiotherapeutin zeigte mir Übungen: Ich musste Kniebeugen machen, durfte über Balken balancieren und auf Wackelkisten stehen. Das machte mir besonders Spaß. Als ich es endlich schaffte, auf der Wackelkiste stehen zu bleiben, jubelte das ganze Team mit mir.
Eine emotionale Rückkehr ins Dorf
Wie dankbar war ich allen Mercy-Ships-Mitarbeitern! Sie hatten meine Hoffnung erfüllt und mir eine neue Zukunft geschenkt! Es war traurig, diese wunderbaren Menschen zu verlassen. Doch ich freute mich unendlich auf mein Zuhause. Würden alle im Dorf mit mir feiern? Jahrelang hatte ich Spott ertragen müssen. Würden die anderen Kinder mich endlich aufnehmen und nicht mehr auslachen? Als ich unser Dorf betrat, schauten alle. Ich lief direkt meinem Vater in die Arme, der es wie alle anderen nicht glauben konnte, was er sah: Eine Julienne, die mit geraden Beinen aufrecht ging! Alle freuten sich aufrichtig. Ich war Gott so dankbar! Mein Traum, Lehrerin zu werden, kann nun endlich wahr werden! Halleluja!
Juliennes Geschichte beruht auf Interviews und Gesprächen mit ihr. Sie wurde frei nacherzählt von unserer Kollegin Lydia Rieger.
Juliennes Heimat Kamerun
TEILEN
TEILEN
Aktuelles aus unserem Blog

Ab morgen darf ich wieder leben
Emmanuel kam als erster Patient in Sierra Leone an Bord der Global Mercy. Seit vier Jahren litt er unter einem faustgroßen Tumor am Hals. Konnte er an Bord endlich geheilt werden?

Eine Überdosis Nächstenliebe
Das Leben der 48-jährigen Apothekerin Stephanie Pape aus Niedersachsen ist alles andere als alltäglich. Und das nicht erst, seitdem sie sich im Januar 2024 auf der Global Mercy zum ehrenamtlichen Dienst gemeldet hat. Denn über das derzeitige Einsatzland Sierra Leone hat sie ihre ganz eigene Geschichte zu erzählen.

Transformation des Gesundheitswesens in Sierra Leone
Transformation des Gesundheitswesens in Sierra Leone: Eine Zukunftsvision für sichere und bezahlbare Operationen. Ein Beitrag von Dr. Austin Demby, Gesundheitsminister Sierra Leone
„Ich unterstütze Mercy Ships, weil medizinische Versorgung ein absolutes Grundbedürfnis des Menschen ist und Mercy Ships diese zu den Ärmsten der Armen bringt."